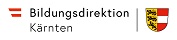Einführung und Inhalt:
Das klassische Idealbild der Kernfamilie hat in den letzten Jahren an Bedeutung eingebüßt und wird zunehmend von alternativen Formen des familiären Zusammenlebens verdrängt. Neben dem herkömmlichen Familienmodell „Vater-Mutter-Kind“ konnten sich vielfältige Lebensformen in der Gesellschaft etablieren, die dem Begriff „Familie“ zu einer größeren Diversität verhelfen und auch andere familiäre Realitätsbilder gestatten.
Demgemäß ist auch die Lebensform „alleinerziehend“ zu einem prägenden Bild in der Familienlandschaft avanciert. Diese Entwicklung bietet den Anlass, den Fokus auf die Lebenssituation der Familienmitglieder in Einelternfamilien zu richten, um zu eruieren, welche verschiedenen Einflussfaktoren die Alltagsrealität von Alleinerziehenden prägen.
Um die Diversität der Lebenssituation von Alleinerziehenden umfassend analysieren zu können, bedarf es zunächst einer kurzen Einführung in grundlegende Aspekte der Familienform „Einelternfamilie“. Dementsprechend erfolgt im ersten Teil der Arbeit ein Einblick in den Status quo der Familienform, indem zunächst eine Begriffserklärung der Termini „Einelternfamilie“ sowie „alleinerziehend erfolgt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Messung des quantitativen Ausmaßes der Familienform.
Basierend auf einer Auswertung umfangreicher Fachliteratur über Einelternfamilien widmet sich die Arbeit in einem nächsten Schritt der Darstellung der Lebenssituation Alleinerziehender in all ihren Facetten. Um einen umfassenden Überblick zu gewährleisten, gliedert sich dieses Kapitel in drei Teilbereiche: Zunächst bildet die Alltagssituation mit ihren vielfältigen Herausforderungen den Gegenstand der Betrachtung. Hier sei vor allem auf die Vereinbarkeitsschwierigkeiten von Familie und Erwerbstätigkeit, welche die Notwendigkeit von Kinderbetreuung durch Institutionen und soziale Kontakte belegen, als auch auf die Problematik einer Ressourcenknappheit an Zeit und Geld verwiesen. Im Anschluss daran finden die gesellschaftliche Akzeptanz der Familienform Eingang in das Kapitel. Abschließend findet sich im letzten Abschnitt eine Betrachtung der sozioökonomischen Aspekte, in deren Rahmen sowohl die Erwerbssituation als auch das erhöhte materielle Deprivationsrisiko thematisiert und deren Einflüsse auf die gesundheitliche Situation von Alleinerziehenden eruiert werden sollen.
Zentrale Ergebnisse des ersten Kapitels:
Obgleich die Begriffe „Einelternfamilie“ oder „alleinerziehend“ häufig das Bild einer Familie suggerieren, welche nur durch das Vorhandensein des erziehungsverantwortlichen Elternteils und seines Kindes bzw. seiner Kinder in einem Haushalt gekennzeichnet ist, ist dieses Verständnis der Einelternfamilie nur selten anzutreffen. Vielmehr kann nicht von „der“ Einelternfamilie gesprochen werden, was es diffizil gestaltet, die Einelternfamilie zu beschreiben.
Grundsätzlich ist die Bildung einer Haushaltsgemeinschaft, die den Elternteil und das minderjährige Kind bzw. die minderjährigen Kinder umschließt, Voraussetzung für die Verwendung des Terminus „Einelternfamilie“. Als weiteres Kriterium wird das Sorgerecht definiert, das dem alleinerziehenden Elternteil obliegt.
Laut Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung gibt es 2020 in Österreich 779.000 Familien mit Kindern unter 15 Jahren. 104.000 dieser Familien sind Einelternfamilien, was einem Anteil von 13,4 % an allen Familien entspricht (Bildmaterial 1). Dabei handelt es sich vorwiegend um Mutter-Kind-Familien, welche in Österreich eine absolute Zahl von 95.000 (91,3 %) aufweisen, denn in nur 8,7 % der Einelternfamilien mit Kindern unter 15 Jahren übernimmt der Vater die Rolle des Alleinerziehenden (Bildmaterial 2).
Zentrale Ergebnisse des zweiten Kapitels:
Das Alleinerziehen als täglicher Akt der Balance stellt den alleinerziehenden Elternteil in vielerlei Hinsicht auf die Probe: Demnach sind Alleinerziehende häufig mit der Herausforderung konfrontiert, das Berufsleben mit dem Familienleben zu vereinbaren. Ferner ergibt daraus oftmals eine Knappheit an zeitlichen und in weiterer Folge finanziellen Ressourcen (Bildmaterial 3). Dementsprechend kommt dem Vorhandensein einer leistbaren Kinderbetreuungseinrichtung, welche mit dem Beruf kompatibel ist, besondere Bedeutung zu, wie die folgende Aussage einer Alleinerzieherin deutlich vor Augen führt:
„Ohne einen Platz in der Kleinkindbetreuung, im Kindergarten sowie im Hort, wäre es mir als Alleinerzieherin nicht möglich gewesen, arbeiten zu gehen.“ (Eigens erstellter Fragebogen zur Veranschaulichung der Lebenssituation von Alleinerziehenden)
Auf der anderen Seite lassen sich aus der Situation des Alleinerziehens aber auch Chancen für die Individuen konstatieren: Hier sei vor allem auf die Entscheidungsfreiheit in Hinblick auf alle Bereiche des täglichen Lebens sowie auf Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung verwiesen.
Bezüglich der gesellschaftlichen Akzeptanz lässt sich feststellen, dass vor allem früher die Ursache für die Alleinerziehersituation ausschlaggebend für die gesellschaftliche Bewertung der Einelternfamilie war: Denjenigen Eltern, deren Alleinerziehersituation durch den Tod des Partners bedingt war, ließ man Mitleid zuteilwerden, während das Bild von lediger Mutterschaft vorwiegend Abneigung evozierte.
Während die Familienform „Einelternfamilie“ in der Vergangenheit in der Bezeichnung „unvollständige Familie“ ihre Entsprechungen gefunden hat, kann man heute davon ausgehen, dass die Einelternfamilie als gleichwertige Alternative zur Kernfamilie Einzug in die familiäre Vielfalt finden konnte.
Unübersehbar ist, dass sich die große Gruppe alleinerziehender Mütter einem besonders hohen Armutsrisiko konfrontiert sieht. Trotz der Tatsache, dass sich die Erwerbstätigenquote von Alleinerzieherinnen im Jahr 2020 auf 71,3 % beläuft und somit höher ausfällt als die der Mütter in Paarfamilien, sind alleinerziehende Mütter mit einer Armutsgefährdungsquote von 31 % mehr als doppelt so häufig von Armutsgefährdung betroffen als der Bevölkerungsdurchschnitt (13,9 %). Im Gegensatz dazu kongruiert das Armutsgefährdungsrisiko der Gruppe von alleinerziehenden Vätern fast vollständig mit dem durchschnittlichen Armutsrisiko der Bevölkerung, was sich dadurch erklären lässt, dass alleinerziehende Männer unter anderem vermehrt Unterstützung durch Personen aus der Verwandtschaft oder dem Freundeskreis in puncto Kinderbetreuung erhalten.
Gemäß den Erwartungen schlägt sich der tägliche Akt des Balancierens von familiären Aufgaben, Erziehungsanforderungen sowie beruflichen Pflichten in der sowohl körperlichen als auch geistigen Gesundheit der Alleinerziehenden nieder. Um die gesundheitliche Situation ist es zumeist schlechter bestellt.
Fazit:
Bereits zu Beginn der Erarbeitung diverser Aspekte der Lebensform „alleinerziehend“ wurde ersichtlich, welches Ausmaß mit der Thematik einhergeht und wie sehr die einzelnen Bereiche der Lebenssituation Alleinerziehender ineinander verflochten sind und sich wechselseitig bedingen.
Demnach konnte in dieser VWA konstatiert werden, dass sich aus der Situation des Alleinerziehens vielfältige Schwierigkeiten für Alleinerziehende ergeben, welche in Korrelation miteinander stehen.
Des Weiteren konnte in dieser Arbeit die Erkenntnis gewonnen werden, dass die große Gruppe alleinerziehender Mütter immer noch für ein besonders hohes Armutsrisiko exponiert ist und sich überdies oftmals in einer erheblich materiell deprivierten Lage wiederfindet.
Die überwiegend prekäre wirtschaftliche Situation und die vielfältigen Herausforderungen in Einelternfamilien legen sozialpolitischen Handlungsbedarf nahe. Es besteht Konsens, dass es spezifischer Maßnahmen bedarf, um die Erwerbsbeteiligung Alleinerzieherinnen zu stärken und ihnen mehr freie Zeit zu verschaffen. Demgemäß wird ein wichtiger Aspekt in der Bereitstellung von kompatiblen Kinderbetreuungsmöglichkeiten gesehen, um eine Vereinbarkeit des Berufslebens mit dem Familienleben zu erzielen.
Anhänge:
Voting Link:
Partner Maturaprojekt-Wettbewerb