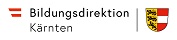1,44 Prozent der gesamten weltweiten CO2-Emissionen entstehen durch die industrielle Herstellung von Ammoniak durch das Haber-Bosch-Verfahren. Stickstoffdünger, der aus dem Ammoniak hergestellt wird, ist essentiell für die Landwirtschaft, da Stickstoff in verwertbarer Form von Pflanzen benötigt wird, um Aminosäuren, Proteine und DNA herzustellen, wobei der reichlich vorhandene Luftstickstoff nicht für Pflanzen biologisch verfügbar ist. Deshalb muss Stickstoff in Form von Nitraten und Ammonium-Verbindungen bereitgestellt werden. Diese Ammonium-Verbindungen werden derzeit zu 96% mit dem Haber-Bosch-Verfahren aus fossilen Brennstoffen hergestellt, das jedoch pro Tonne produziertem Ammonium mind. 1,6 Tonnen CO2 in die Atmosphäre entlässt. Um den voranschreitenden Klimawandel aufhalten zu können, müssen sie in der Zukunft nachhaltig und CO2-arm gewonnen werden. Das Ziel dieser Arbeit ist, eine nachhaltige Methode der Ammoniakproduktion, die Gewinnung durch stickstofffixierende Prokaryoten, den Cyanobakterien, zu untersuchen und zu erforschen. Auch für eine Landwirtschaft in Österreich, die unabhängig von fossilen Brennstoffen werden will, ist eine alternative Erzeugungsmethode von Ammoniak unabdingbar - außerdem kann damit die wirtschaftliche Abhängigkeit vom fossilen Energiemarkt reduziert werden. Darüber hinaus wird Ammoniak durch seinen hohen Wasserstoffgehalt als Energieträger der Zukunft gehandelt.
Unsere Motivation für dieses Projekt entstand im Zuge einer Recherche zu einem Referat in der Schule. Dabei erfuhren wir, wie viel CO2 die Ammoniakproduktion jährlich ausstößt. Da wir vom Klimaschutz und von einer nachhaltigen Zukunft überzeugt sind, wollten wir dieses Problem angehen, womit wir den Entschluss fassten, Ammoniak durch Mikroorganismen zu produzieren, die uns zuvor nur aus einem Computerspiel bekannt waren. Nach einiger Recherchearbeit stellten wir jedoch fest, dass diese Cyanobakterien, die wir verwenden wollten, nur für die Eigenproduktion Ammoniak herstellten. Dies ließe sich durch genetische Modifikation ändern - und genau das versuchen wir gerade. Unser Ziel dabei ist es, durch Mutagenese ammoniakproduzierende Cyanobakterien zu gewinnen und die Grundlagen für eine spezifische Modifikation mit CRISPR/Cas9 durch den Bau eines Elektroporators zu schaffen. Damit liefern wir einen Beitrag zu einer CO2-neutralen Zukunft.
In diesem Forschungsprojekt beschäftigten wir uns mit der Kultivierung von Anabaena variabilis PCC 7120 und den besten Wachstumsbedingungen. Durch Mutagenese wurden Cyanobakterien so genetisch verändert, dass sie potenziell mehr Ammoniak ausscheiden können.
Des Weiteren führten wir ein CRISPR/Cas9-Geneditierungsexperiment an E. coli durch, um das CRISPR/Cas9-System zu erproben. Die Erkenntnisse wurden für die Planung eines CRISPR/Cas9-Experiments an Anabaena variabilis verwendet, da dieses System für jeden Zielorganismus und jedes Zielgen speziell angepasst werden muss.
Untersuchungen zum Verhalten von Anabaena v. in Gegenwart verschiedener Antibiotika wurden angestellt, um wichtige Informationen für das CRISPR-Experiment zu erhalten. Außerdem bauten wir für eine Weiterführung der CRISPR/Cas9 - Modifikation einen Elektroporator. Ein Elektroporator ist ein Laborgerät, das durch das kurzzeitige Anlegen von hohen Spannungen die Zellmembran der Bakterien porös werden lässt, wodurch Stoffe ins Bakterium eingeschleust werden können, was wiederum eine Vorraussetzung für die genetische Veränderung durch CRISPR/Cas9 ist. Diesen Elektroporator entwickelten wir am 3D-Drucker mit selbst gebauter Hochspannungstechnik.
Zudem war es noch wichtig, für die Bakterien eine geeignete Lebensumgebung zu schaffen, sodass Bakterienkulturen wachsen und gedeihen können, deren Ammoniakproduktion überwacht wird. Dafür müssen auch wichtige Wachstumsparameter wie der pH-Wert dauerhaft überwacht werden. Deswegen haben wir eine Datenbankanbindung und Datenvisualisierung für eine pH-Wert - und Temperaturaufzeichnung entwickelt.
Die Idee, durch den Einsatz von Mikroorganismen wie Cyanobakterien Ammoniak zu erzeugen, ist auf dem Markt bisher nicht vertreten. Zwar ist das Konzept in der Forschung nicht neu, jedoch werden tatsächliche Effizienzversuche und ökonomische Faktoren großteils ignoriert, weil andere Konzepte der nachhaltigen Ammoniakproduktion oft kurzfristig einfacher umzusetzen sind. Diese involvieren sehr oft einfach nur erneuerbar erzeugten Wasserstoff aus Elektrolyse, der danach mit dem selben Haber-Bosch-Verfahren wie zuvor zu Ammoniak umgesetzt wird. Dies hat trotzdem weiterhin einen riesigen Energieverbrauch, den man nicht außer Acht lassen darf, wobei die CO2-Emissionen einigermaßen zurückgefahren werden. Dafür müssen jedoch riesige Flächen, z.B. in der Sahara, mit Photovoltaikanlagen überzogen werden, da die zuvor fossil erbrachte Energie nun elektrisch zur Verfügung gestellt werden müsste. Dagegen haben Cyanobakterien einen entscheidenden Vorteil. Sie können effektiv in mittelgroßen Anlagen gezüchtet werden, und die Ammoniakgewinnung benötigt kein mehrstufiges Verfahren. Außerdem ist die Biotechnologiebranche gerade allgemein ein massiver Innovationstreiber, und große Effektivitätssteigerungen bei der Ammoniakproduktion der Cyanobakterien in näherer Zukunft stehen damit ebenfalls in Aussicht.
Das Projekt ist noch nicht beendet, daher können hier nur vorläufige Ergebnisse angeführt werden.
Dazu gehört die Gewinnung von Cyanobakterien-Mutanten, die potenziell eine höhere Ammoniumausscheidung besitzen. Nach der Mutagenese müssen diese Bakterien im weiteren Projektverlauf auf diese Eigenschaft überprüft werden.
Ebenso wurde ein Konzept für ein CRISPR/Cas9-Genomeditierungsexperiment entworfen, dass zum Beispiel im Rahmen folgender Diplomarbeiten an der HTL Braunau umgesetzt werden kann.Der Bau des ersten Elektroporator-Prototyps ist bereits abgeschlossen und soll im weiteren Verlauf auf seine Funktionsfähigkeit geprüft werden, indem Versuche mit Bakterien durchgeführt werden. Nicht zuletzt soll hier der Bioreaktor-Prototyp erwähnt werden, der ideale Bedingungen für das Wachstum von Anabaena variabilis PCC 7120 bereitstellt. Dafür sind unter anderem eine Messdatenerfassung durch diverse Sensoren und einen Raspberry Pi sowie eine Messdatenaufbereitung durch Grafana implementiert worden.
Einen guten Stamm von Cyanobakterien, der viel mehr Ammoniak als die bisherigen Stämme produziert, könnte man überall verwenden. Es gibt z.B. einige Modellversuche dazu, Cyanobakterien-Biomasse statt Kunstdünger für zu verwenden, um Felder zu düngen. Der Vorteil von Cyanobakterien, die mehr Ammoniak produzieren, könnte sein, dass man sie in einer kleinen, offenen Pfütze wachsen lassen und danach auf einem Feld verteilen könnte, wobei ein Bauer keinen Stickstoffdünger mehr kaufen müsste. Unsere Cyanobakterien wären bei solchen Versuchen viel effektiver. Des weiteren könnten Ammoniakproduktionslinien entwickelt werden, wo gezielt industriell Ammoniak erzeugt wird. Ein großer Pluspunkt dieser Anwendung ist auch, dass neben Ammoniak bei der Stickstofffixierung der Cyanobakterien auch Wasserstoff frei wird, der genauso verwendet werden könnte. Dies könnte man in einem großen, industriellen Prozess verwirklichen, der auch profitabel sein kann. Diese Rentabilität haben wir im Rahmen des Wirtschaftsunterrichts an der Schule auch als Businessplan entwickelt, und somit einige Optionen dargestellt.
Anhänge:
Voting Link:
Partner Maturaprojekt-Wettbewerb