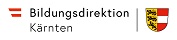Boden bildet die Grundlage für das Leben auf unserem Planeten. Täglich werden in
Österreich aber 13 ha dieser Grundlage für Häuser, Straßen oder Gewerbegebiete
verbaut. Circa 40% davon werden unwiederbringlich versiegelt. Bei dieser
Versiegelung von Flächen wird der Boden mit einer undurchlässigen Schicht, wie
Asphalt, überzogen. Dabei gehen alle Bodenfunktionen bis auf die Trägerfunktion
verloren. Hervorzuheben ist der Verlust der Produktionsfunktion, welche die Basis für
die landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion darstellt. Durch die anhaltende
Versiegelung geht die Ernährungssicherheit Österreichs somit zusehends verloren.
Deswegen muss unser Boden geschützt werden.
Hierbei spielt nicht nur quantitativer, sondern auch qualitativer Bodenschutz eine große
Rolle. Ersteres, der quantitative Bodenschutz, wird neben anderen Aspekten des
Bodenverbrauches von Lena Krawanja-Ortner behandelt, wobei auf mehrere
Schutzmaßnahmen eingegangen wird. Dass diese Schritte schon viel früher hätten
gesetzt werden sollen, zeigt Julian Hofer anhand der geschichtlichen Entwicklung des
Bodenverbrauches auf. Zweiteres, den qualitativen Bodenschutz, thematisiert
Andreas Strutzmann, indem er verschiedene Bodenbearbeitungsmaßnahmen
gegenüberstellt.
Ziel der Diplomarbeit ist es, den Boden als Grundlage unseres Lebens zu
kennzeichnen und die damit verbundene Problematik des Bodenverbrauches
auszudrücken. Damit unterstützt diese Arbeit die Bewusstseinsbildung für den Boden.
In der empirischen Auseinandersetzung mit dem Thema Bodenverbrauch wertet Julian
Hofer Daten des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen aus, stellt diese
grafisch dar und interpretiert sie. Währenddessen führt Lena Krawanja-Ortner
Interviews mit Personen unterschiedlicher Fachgebiete durch, um den
Bodenverbrauch aus mehreren Blickwinkeln zu beleuchten. Mit der Frage welche
Bodenbearbeitungsmaßnahmen von Seiten der Landwirtschaft den Humusaufbau
unterstützen, beschäftigt sich Andreas Strutzmann. Dafür analysiert er Bodenproben
verschiedener Standorte.
Basis des theoretischen Teiles sind die Hauptwerke „Boden für alle“ des
Architekturzentrum Wiens, das Buch von Hans Peter Rusch „Bodenfruchtbarkeit“
sowie „Österreichische Geschichte: Ökonomie und Politik“ von Roman Sandgruber.
Die 2020 erschienene Herausgeberschaft des Architekturzentrum Wiens gibt einen
umfassenden und detaillierten Einblick über den Bodenverbrauch in Österreich und ist
ein aktuelles und kritisches Werk. Roman Sandgruber fasst die Wirtschaftsgeschichte
Österreichs in seinem Buch gut verständlich zusammen. Herr Hans Peter Rusch
beschreibt in seinem Buch die Thematik Bodenfruchtbarkeit auf eine sehr interessante
und aufschlussreiche Weise.
Nach einer Analyse verschiedener Bearbeitungsmethoden von landwirtschaftlichen
Flächen ist grundsätzlich festzustellen, dass eine Reduzierung der Bodenbewegungen
auf unseren Äckern ein erstrebenswertes und dringendes Ziel wäre. Durch die
konventionelle Bodenbearbeitung erodieren jährlich 16,2 Tonnen pro Hektar an
Boden. Bei einer deutlich verringerten Bodenbearbeitung, wie durch die Direktsaat,
kann der Bodenabtrag jährlich auf ca. 2,2 Tonnen pro Hektar gesenkt werden.
Außerdem kann der Humus- oder Bodenaufbau durch vielfältige Fruchtfolgen und
intensiven Zwischenfruchtanbau gewährleistet werden. Dies wird vor allem bei einer
Bewirtschaftung nach den Prinzipien der konservierenden Landwirtschaft angewandt.
Neben der Betrachtung von qualitativem Bodenschutz wurde durch Interviews auch
der quantitative Schutz näher beleuchtet. Die Gespräche ergaben, dass
Bodenverbrauch ein massives Problem in Österreich darstellt und dass dieser
umgehend verringert werden muss. Das soll durch ein gemeinsames Bekenntnis zum
Bodenschutz erzielt werden. Neben besserer Kooperation und Kommunikation ist die
Bewusstseinsbildung weiter voranzutreiben. Best-Practice Beispiele zeigen dabei, wie
es geht. Darüber hinaus sind viele zusätzliche Maßnahmen von Seiten der Politik zu
setzen, ohne die es, wie bisher, keine großen Verbesserungen geben wird. Damit beim
Bodenschutz die Motivation nicht verloren geht. muss sich der Schutz nächster
Generationen ständig vor Augen geführt werden.
Richtet man den Blick von der gegenwärtigen Situation des Bodenverbrauches auf
dessen geschichtliche Einflüsse, erkennt man, dass ein eindeutiges Fazit zu den
verschiedenen Faktoren kaum möglich ist. Im Rahmen der Diplomarbeit war es nur
möglich einen groben Überblick zu erhalten. Folgende Erkenntnisse wurden
gewonnen:
• Große Unterschiede sind zwischen einer regionalen Betrachtungsebene (z.B.:
Gemeinden) und einer Betrachtung des gesamten Staates Österreich zu
erkennen.
• Das Bevölkerungswachstum und die Bevölkerungsstruktur haben einen
maßgeblichen Einfluss auf den Bodenverbrauch. Vor allem in Kombination mit
dem in Österreich noch sehr weit verbreiteten „Häuslbauertum“, wonach fast
jeder nach einem flächenintensiven Einfamilienhaus strebt.
• Die Agrarrevolution ist damit gekennzeichnet, dass sehr großes Potential für die
Wertschätzung des Bodens und dessen Schutz vorliegt.
• Die Energiewirtschaft hat wenig bis gar keinen Einfluss, wobei der Ausbau von
erneuerbaren Energien sowohl weitere Problemzonen wie auch Potenzial mit
sich bringt.
• Gewerbe- und Industriegebiete sind aus Sicht des Bodenverbrauches in
Österreich eine der größten Problemzonen, woraus großer Handlungsbedarf
resultiert.
• Der Tourismus hat an und für sich einen geringen Einfluss, wobei einige jüngere
Entwicklungen, wie Chalet-Dörfer, zu verurteilen sind.
• Beim Thema Verkehr und Transit spielen vor allem die große Verankerung des
Autos und der daraus resultierende Straßenbau eine große Rolle.
• Die Wirtschaft und dessen Wachstum als Gesamtes hat keinen direkten
Einfluss auf den Bodenverbrauch.
Anhänge:
Voting Link:
Partner Maturaprojekt-Wettbewerb