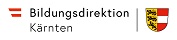Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Evaluierung der Genauigkeit ausgewählter Analysemethoden der quantitativen Analytik. Dabei behandelt diese Arbeit die drei quantitativen Analysemethoden Gravimetrie, Titration und Photometrie. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wird im ersten Teil der Arbeit auf die Bewertung der Genauigkeit eingegangen. Hierbei sind vor allem die Richtigkeit und die Präzision als Kriterien ausschlaggebend, welche durch die beiden statistischen Kennzahlen – dem arithmetischen Mittel beziehungsweise der Standardabweichung – quantifiziert werden. Dabei beschreibt die Richtigkeit die Abweichung vom theoretisch richtigen Wert und die Präzision beschreibt die Streuung der einzelnen Messergebnisse. Als relatives Maß für die Güte der Messmethode wird außerdem der Variationskoeffizient herangezogen, da dieser Ergebnisse verschiedener Größenordnungen vergleichbar macht. Des Weiteren befasst sich dieser Teil der Arbeit mit den theoretischen Grundlagen der einzelnen Analysemethoden. Für die Gravimetrie wurde die Fällung und das Löslichkeitsprodukt erläutert. Bei der Titration wurde von den drei Arten der Titration ausschließlich die Säure-Base-Titration behandelt. Des Weiteren wurde im Kapitel der Titrimetrie die Darstellung des Titrationsfortschrittes durch eine Titrationskurve sowie die Rolle und Funktionsweise eines Indikators erläutert. Bei der Photometrie liegt der Fokus auf der Theorie der Lichtabsorption, sowie dem Zusammenhang zwischen Absorbanz und Konzentration durch das Lambert-Beersche Gesetz. Bei allen drei Methoden werden auch die theoretischen Grundlagen für mögliche Fehler, die nicht Fehlern in der Durchführung der Versuche geschuldet sind, beschrieben. Beispiele für derartige Fehler sind der Indikatorfehler, der durch die Abweichung des Umschlagpunktes des Indikators vom Äquivalenzpunkt der Titration auftritt, oder die Mitfällung bei der Gravimetrie, welche das Ausfallen von Fremdionen beschreibt.
Der zweite Teil der Arbeit besteht aus der Durchführung und Auswertung von jeweils einem Versuchsaufbau zu den drei Analysemethoden. Für die Gravimetrie wurde die Fällung von Bariumsulfat aus einer Bariumchloridlösung mit Schwefelsäure untersucht. Dazu wurde Bariumsulfat ausgefällt, filtriert und durch das Veraschen des Filterpapieres getrocknet. Die erhaltene Masse wurde mit der theoretisch maximalen Ausbeute verglichen. Die Titration wurde anhand der Titration von Natronlauge gegen Salzsäure untersucht. Hierbei wurde die Konzentration der hergestellten Natronlauge durch eine Titration gegen Kaliumhydrogenphthalat ermittelt. Anschließend wurde mithilfe dieser Natronlauge die Konzentration einer Probe mit Salzsäure ermittelt, welche mit der vom Hersteller genannten Konzentration verglichen wurde. Bei der Photometrie wurde die Konzentration von Kupfersulfatlösung gemessen. Dazu wurde aus einer selbst hergestellten Kupfersulfatlösung eine Verdünnungsreihe erstellt, aus welcher der Extinktionskoeffizient ermittelt werden konnte. Über die Messung der Absorbanz der Probe konnte durch das Lambert-Beersche Gesetz auf die Konzentration geschlossen werden. Auch hier wurde der Unterschied zur Angabe des Herstellers ermittelt.
Um Aussagen über die Genauigkeit treffen zu können, musste jeder Versuch mehrfach durchgeführt werden. Die Auswertung der Ergebnisse lieferte für die Gravimetrie eine durchschnittliche Abweichung 0,38 % vom gesuchten Ergebnis. Auch die Richtigkeit der Titration ist mit einer Abweichung von 0,458 % ähnlich hoch. Mit einem durchschnittlichen Fehler von 1,575 % ist die Richtigkeit der Photometrie als dritte untersuchte Methode deutlich niedriger. In Bezug auf die Präzision ergibt die Auswertung folgendes: Mit einer Standardabweichung von 1,851 ∙ 10^-6 mol ist die Gravimetrie deutlich genauer als die Titration mit einer Standardabweichung von 7,99 ∙ 10^-4 mol/l. Auch hier liegt die Photometrie mit einer Standardabweichung von 1,591 ∙ 10^-3 mol/l zurück. Die Variationskoeffizienten sind für diese drei Methoden 0,19 %, 0,80 % beziehungsweise 1,62 %. Der Variationskoeffizient der Gravimetrie beträgt also nur ein Viertel vom Variationskoeffizienten der Titration und nur ein Achtel von dem der Photometrie. Außerdem wurde zusätzlich zur Auswertung der Ergebnisse noch analysiert, welche Fehler tatsächlich eingetreten sind beziehungsweise, ob die im Theorieteil beschriebenen Fehlerquellen in diesem Versuch relevant sind.
Die Methode der Gravimetrie hat den entscheidenden Nachteil, dass sie mit einem sehr hohen Zeitaufwand verbunden ist; der in dieser Arbeit durchgeführte Versuch nimmt beispielsweise zirka 100 Minuten in Anspruch. Des Weiteren muss die zu untersuchende Komponente gezwungenermaßen in ein Produkt mit niedrigem Löslichkeitsprodukt überführt werden. Auch bei der Photometrie gelten ähnliche Einschränkungen, da die untersuchte Spezies nicht farblos sein darf. Die Titration hat den Vorteil, dass der Zeitaufwand mit zirka 30 Minuten deutlich geringer ist als bei der Gravimetrie und die drei verschiedenen Titrationsarten ermöglichen eine große Anzahl an Einsatzgebieten.
Um die Aussagekraft der Untersuchungen zu verbessern, wäre es notwendig, die Größe der Stichprobenumfänge deutlich zu erhöhen, um die Auswirkung subjektiver Fehler, wie beispielsweise das falsche Ablesen des Volumens auf einer Bürette, zu minimieren. Die Steigerung der Anzahl der Versuchsdurchläufe hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit überstiegen.
Anhänge:
Voting Link:
Partner Maturaprojekt-Wettbewerb