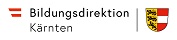Das Projekt weist eine Kombination verschiedener Bereiche auf. Zum einen benötigt man für das Verständnis der chemischen Aspekte ein gewisses Hintergrundwissen, zum anderen ist es
jedoch ebenfalls sehr wichtig, die elektronischen Komponenten zu verstehen. Diese Verbindung macht unser Projekt innovativ und sehr zukunftsorientiert. Mit dieser Kombination kann ein effizienter Lösungsweg gefunden werden.
Grundsätzlich kann ein Mensch aufgrund von chemischen Spuren, die er hinterlässt nachgewiesen werden. Jeder Mensch hinterlässt diese charakteristische Spur und wir setzten uns zum Ziel, den Nachweis aufgrund dieser Stoffe zu ermöglichen.
Dafür beschäftigten wir uns zu Beginn genau mit den ausgestoßenen Stoffen, genannt VOCs (Volatile Organic Compounds). Dafür stellten wir verschiedene Testgase dieser entsprechenden flüchtigen organischen Verbindungen her. Darunter waren Aceton, Ammoniak, Propanol und Essigsäure. Außerdem stellten wir eine Harnstofflösung her. Mit den Testgasen und hergestellten Lösungen führten wir Messungen im IR-Spektrometer durch und maßen verschiedene Konzentrationen, ebenso wie unseren Atem. Ein Mensch stößt diese Stoffe nur in sehr geringen Mengen aus, deshalb verringerten wir die Konzentrationen so weit, bis sie nicht mehr nachweisbar waren. Die gemessenen Konzentrationen lagen in einem Bereich zwischen 100ppm und 100ppb. Diese Messergebnisse stellten dann die Grundlage für unsere nächsten Schritte dar.
Wir wollen den technischen Nachweis mithilfe einer Kombination von verschiedenen Sensoren ermöglichen. Zum einen zwei verschiedenen VOC-Sensoren. Diese können die besagten organischen Stoffe nachweisen, die ein Mensch ausstößt, wie beispielsweise Ammoniak, Aceton, Isopren und viele weitere. Zusätzlich zu diesen Sensoren kombinieren wir ebenfalls einen CO2-Sensor.
Diese Sensoren steuern wir mittels eines ESP32 und der Arduino IDE an und werten sie so aus.
Diese Sensorkombination testeten wir mit selbst hergestellten Testgasen, darunter Ammoniak, Aceton, Propanol, Essigsäure und ebenfalls eigene Atemproben, sowie Harnstoff. Durch die Kooperation mit der Universität Innsbruck hatten wir ebenfalls die Möglichkeit, Messungen am Standort in Innsbruck durchzuführen. Dabei maßen wir unter anderem einzelne VOCs, wie Aceton, Ethanol und Isopren. Außerdem führten wir eine Messung in einer gasdichten Kammer durch, die es uns ermöglichte, sowohl den eigenen Atem, als auch abgegebene Stoffe von der Haut zu messen. Ebenfalls führten wir Messungen in einem Privatraum zuhause durch, um die Anwendungssituation bestmöglich zu rekonstruieren.
Diese Kombination versuchen wir mittels einem besonderen Testaufbau noch weiter zu optimieren. Dazu verbinden wir eine Gaschromatographie-Säule in einem Ofen mit den Sensoren. Dazu stellten wir sicher, dass die GC-Säule konstant mit Stickstoff durchflossen wird. Eine Schnittstelle im Kreislauf mit einem Septum ermöglicht es, die Testgase die wir messen wollen einzuspritzen. Diese durchlaufen dann die GC-Säule im Ofen und gelangen anschließend zu den Sensoren.
Die aktuellen Ergebnisse sind vielversprechend. Der CO2-Sensor kombiniert mit den VOC-Sensoren verzeichnete signifikante Ausschläge bei den Messungen sowohl in der Schule, als auch bei den Messungen in Innsbruck. Der CO2 Sensor weist bei den Messungen in der gasdichten Kammer und bei dem privaten Raum einen linearen Anstieg auf, diese Verläufe können im nächsten Punkt, unter Bildmaterial, besser nachvollzogen werden. Dabei ist ein Unterschied der gemessenen Werte an den unterschiedlichen Orten zu vernehmen. Die gemessenen Konzentrationen aller Sensoren waren in der gasdichten Kammer stärker, als im privaten Raum. Diesen Unterschied begründen wir mit den unterschiedlichen Bedingungen. Auch die Messungen mit dem Testaufbau verzeichneten bereits vielversprechende Ergebnisse. Dieser Aufbau muss jedoch in Zukunft noch weiter optimiert werden. Mit den aktuellen Ergebnissen ist es, durch unsere Messungen belegt, möglich nachzuweisen, ob Menschen anwesend sind.
Die Arbeiten sind zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht fertiggestellt. In Zukunft planen wir, die Messdaten in einer Datenbank zu speichern, um die Ergebnisse der Messungen immer abrufbar, sicher zu erfassen. Weiters planen wir die Herstellung von Platinen für die Sensoren und die Mikrokontroller. Da bei einer tatsächlichen Anwendung der verfügbare Raum minimal ist, können wir so effizient Platz sparen. Diese Optimierungen sollen die Anwendung noch präziser machen und in Zukunft das Leben von Menschen retten.
Anhänge:
Voting Link:
Partner Maturaprojekt-Wettbewerb